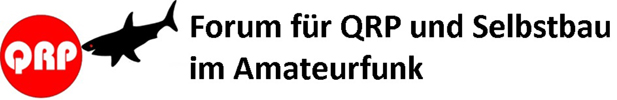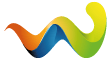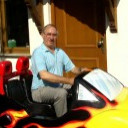
Hallo DO2AH,
mal zur besseren Verständigung. Spannung von der Sache her ist eine Differenz , ob nun mechanisch oder wie hier bei der Hochfrequenz , so auch bei der Gleichspannung.
Wenn man Spannung sagt , meint man oft den einen Punkt gegen den anderen. Spannung an der Netzsteckdose bezieht sich auf N gegen die Phase L .
Auch der Fuchskreis ist so . Wenn du nun in diesen nur magnetisch , also isolierte Koppelwicklung , einkoppelst, bildet sich über den Schwingkreis eine resultierende Spannung aus.
Spannung von einer Seite des Schwingkreises gegen die andere Seite des Schwingkreises. Eine Seite koppelst du direkt in den Langdraht mit Lambda halbe. Aber ohne einen Gegenpol
wird kein Strom in die Antenne gebracht , da die andere Seite des Fuchskreises keine Verbindung zum Freiraum hat, der erste Anschluss ja wohl über die Antenne. Mechanisch gesehen
versuchst du nun gegen eine Leere zu schieben. Man braucht etwas an Gegenpol, ohne geht es nicht, theoretisch. In der Praxis gibt es beim Aufbau Streukapazitäten und im Ergebniss
stellt man fest und behauptet es funktioniere , ja schon aber warum und mit welchem Wirkungsgrad. Also Spannung braucht 2 Seiten damit dann auch Strom fließen kann.
73 de
Alles anzeigen
Zu diesen Ausführungen muss ich jedoch noch Etwas sagen, um den Gedankengang nachzuvollziehen:
Früher haben wir in der Schule den Resonanzversuch mit zwei identischen Stimmgabeln auf zwei Schallkästen gesehen. Wurde die eine Stimmgabel angestoßen und klang nach, hat die zweite Stimmgabel mitgeschwungen. Ohne die zweite Simmgabel angeschlagen zu haben, kam ihre Tonschwingung ebenso aus dem Schallkasten heraus. Also Schallenergie.
Dasselbe passiert auch im zweikreisigen Bandfilter. Somit muss der zweite Schwingkreis nicht geerdet sein, um an den beiden Anschlüssen hochohmig oder über eine massefreie Koppelspule niederohmig und massefrei die selektierte HF-Spannung abnehmen zu können.
Somit vermisse ich am Fuchskreis keine Masse, sondern sehe darin einen Schwingkreis, an dem die Antenne angeschlossen wird, um die ankommenden HF-Schwingungen mit mehr Fläche und somit Energie einzufangen und kräftiger zum Schwingen zu bringen. Eine Koppelschleife oder ein zweiter Schwingkreis am Fuchskreis gestatten massefreies Abnehmen der Schwingungen.
Umgekehrt beim Senden könnte ich mir das auch nur so vorstellen, dass die HF-Energie im Kreis lediglich mit Koppelkreis angepasst an den Scheinwiderstand der Antenne abgegeben wird, entweder massefrei an einen Dipol und nur dann geerdet, wenn man mit Antenne gegen Erde arbeitet. In diesem Falle wäre die Erde nicht Erde im Sinne von Masse, sondern gegen einen einzelnen Antennendraht das Gegengewicht anstelle des zweiten Dipolschenkels.
Am Amateurfunktransceiver wird ja die Gerätemasse und Erdung (PE) getrennt von der Erdung der Antenne behandelt, obwohl Staberder, Schutzleiter und Potenzialausgleich an einem Punkt zusammengefasst werden.
Was ich zuweilen auch gesehen habe, dass die Erdung einer Antenne abgestimmt wurde mit einem Erd-Resonanzkreis und dem eine hohe Bedeutung beigemessen wurde.
Nun noch ein Gedanke: In Rothammels Antennebuch ist irgendwo eine Schlitzantenne beschrieben, bei der entweder in einer Metallplatte oder im Rohr eines Masten ein Schlitz ausgenommen wurde und an dessen Mittenkanten eine symmetrische Antennenleitung angeschlossen wurde.
Hier wird ein Schleifendipol als Schlitz dargestellt. Die Fläche drumherum ist recht groß.
Statt eines Schleifendipols kann man ja z.B. für VHF / UHF auch einen Ring nehmen, wie bei einer MLA für VHF/UHF.
Nun stelle man sich mal als nächstes Bild im Gedankengang vor, anstelle des Schlitzes würde man aus einer großen rechteckigen Metallplatte in der Größe einer Magnetic-Loop-Schleife eine runde Platte ausschneiden und von diesem Loch her zu einem der zwei schmalen Ränder das Blech aufschlitzen, so dass die Rundung nicht mehr geschlossen ist.
Der Schlitz an sich ist schon ein Festkondensator und nun könnte dazu parallel noch ein Drehko geschaltet werden.
Eine Koppelschleife identisch einer normale MLA dient der 50-Ohm-Auskopplung zum TCVR.
Jetzt hat man praktisch ein Gebilde, wie eine MLA mit einem Paar Blechen zu beiden Seiten der Auftrennung des Ringes.
Praktisch einen Schwingkreis mit zwei Dipolflächen.
Da wäre ich mal gespannt, was ein Simulationsprogramm dazu für eine Aussage liefert.