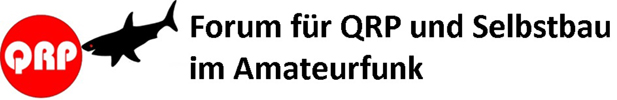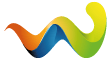Hin und Rücklauf werden bestimmt und das was Du meinst, was sonst in HW gemacht wird macht der MC
in SW.
Hallo Markus,
eine Brücke ist eine Brücke. Es gibt Brückenschaltungen, mit deren Hilfe das SWR bestimmt werden kann. Nicht jede Schaltung zur Bestimmung des SWR ist eine Brücke. T507 zusammen mit den Dioden ist keine Brücke. Das hat nichts damit zu tun, was dann die MCU in Software macht. Warum sollten wir das dann eine Brücke nennen? Mit falschen Begrifflichkeiten kommen wir nicht sinnvoll weiter. Das schafft Verwirrung und führt schnell zu Fehlern.
Wenn Euch aber der Ausdruck 'Tap' also eine
Abgriff für die hin- und rück-laufende Spannung besser gefällt, so soll mir das auch recht sein.
Was hat "Tap" im Sinne von Anzapfung mit dieser Schaltung zu tun. Wenn man das im Sinne von "Anzapfen" des Signals für Messungen betrachtet, wären wohl sehr viele Messungen mit einem "TAP" verbunden.
PEP bezog sich auf die augenblickliche Maximalleistung
Die Augenblicksleistung = Momentanleistung ist etwas anderes als PEP.
Weiterhin: augenblickliche Maximalleistung ist ein Widerspruch in sich. Ein Maximalwert für eine bestimmte Zeitspanne bekommt man, wenn man einen Wert über diese Zeitspanne beobachtet und das Maximum des Wertes bestimmt. Die augenblickliche Maximalleistung wäre der Maximalwert für die Zeitspanne des Augenblicks.
>die Arbeitsweise der PA weg von der notwendigen Arbeitsweise geändert wird
Diese Aussage ist mir nicht klar. Eine Änderung der TP oder Ihre Überbrückung, ist ja nur eine
temporäre Aktion, die nur zur Ermittlung des PA Verhaltens dient. Was ist daran falsch?
Aber genau bei dieser temporären Änderung ändert sich die Arbeitsweise der PA und wird der verwendete "Leistungswert" ermittelt.
Die Lastimpedanz bei verschiedenen Frequenzen hat einen Einfluss auf die Arbeit der PA. Wenn ich diese frequenzabhängige Lastimpedanz ändere (anderer TP) dann ändere ich die Arbeitsweise der PA.
73 Ludwig