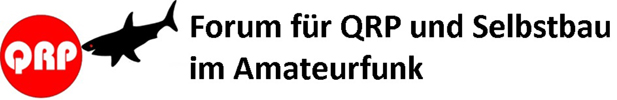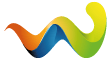Hallo zusammen,
wie im Thread Neuer Verstärker für Breitband Magnetantenne bereits angesprochen, möchte ich einen Verstärker für verkürzte Dipol-Empfangsantennen entwickeln und mit euch diskutieren.
Warum ein Dipol und nicht das bekannte Prinzip "MiniWhip"?
Nach meinen Erfahrungen ist ein Dipol dem Monopol in mehrerlei Hinsichten überlegen:
- Der Antennengewinn ist unabhängig von der Länge der Zuleitung
- Die Nullstelle im Richtdiagramm des Dipols kann zur Störunterdrückung genutzt werden
- Die Antenne empfängt nur dort, wo "ich es will", es wird kein QRM entlang der Zuleitung aufgenommen
Nachdem der Mehraufwand für einen symmetrischen Aufbau nun auch nicht sehr groß ist, steht die Entscheidung fest.
Bisher verwende ich übrigens seit 2018 einen Klon von Günters SIMWA, eine sehr gut durchdachte und performante Schaltung.
Das größte Optimierungspotenzial sehe ich im Eigenrauschen bei angeschlossenem Dipol. Es setzt sich aus meiner Sicht zusammen aus:
- dem recht großen Eigenrauschen der FET Eingangsstufe
- Gleichtaktstörungen auf der Zuleitung durch unvermeidbare Asymmetrien im Dipol bzw. seines Umfelds
- evtl. Intermodulationsprodukten. Die kapazitätsarmen FETs verstärken ja bis mehrere 100 MHz und werden damit auch von Frequenzen "zugestopft", die nach dem Ausgangstreiber (Übertrager etc) nicht mehr zu sehen sind
Damit habe ich eine Frage an alle Mitleser. Welchen Rauschpegel erreicht ihr bei 14 MHz mit euren aktiven E-Feld Antennen, bei welcher Antennengröße (Kapazität)?
Ich hatte keinen Wert kleiner S2 erreicht, definitiv höher als mit einem passiven Dipol.
Versuchsweise möchte ich den Antennenverstärker explizit nicht hochohmig machen, sondern entweder im Bereich weniger kOhm oder sogar niederimpedant als Transimpedanzwandler.
Ein Transimpedanzwandler erreicht eine sehr hohe Leistungsverstärkung bei geringstem Rauschen, ein invertierender OpAmp Verstärker könnte eben etwas mehr Leistung aus der Antenne holen.
Bsp: ein verkürzter Dipol mit 10 pF pro Arm hat bei 3 MHz eine Impedanz von 10 kOhm am Einspeisepunkt, zumindest bei "großen" Aktivantennen braucht es also nicht die super hochohmigen Eingänge.
Was sagt ihr dazu? Oder kennt ihr sogar ähnliche Ansätze?
73
Bernhard