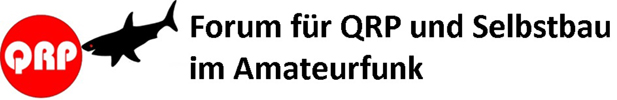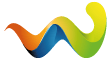Eine Hochfrequenzleitung ist ein sehr simples Gebilde. Das verleitet dazu, die Schwierigkeit, ihre Funktion zu verstehen, zu unterschätzen.
Die Resultate dieser Diskrepanz kann man besonders in der Amateurliteratur finden. Die Irritationen scheinen einfach nicht ausrottbar zu sein. Hätte ich für jeden Unsinn, den ich im Zusammenhang mit HF-Leitungen gelesen und gehört habe, einen Orden erhalten, könnte ich vermutlich durch das Gewicht schon nicht mehr laufen.
Auch der Beitrag über Koaxkabel im FA 1/07 hätte leider die Last vergrößert. Dies ist umso bedauerlicher, als man beim FA doch kürzlich nach einer missglückten Funktionsbeschreibung auf den blauen Seiten aufgeklärt wurde (s. Berichtigung dazu).
Es ist nun einmal schlichtweg falsch, zu behaupten, dass das Kabel für eine Übertragung ohne Reflexionen an BEIDEN Ende mit Z abgeschlossen sein muss (S. 54, 2. Sp. Mitte). Und wie hat man sich den eine Reflexion über die Entfernung NULL (vom Kabel zur Quelle) vorzustellen? (54, 3., Mitte). Lustig auch die Vorstellung einer hin- und herpendelnden RÜCKLAUFENDEN Welle (55, 1, unten).
Dies sind nur ein paar Beispiele.
Wer die HF-Leitung verstehen will, sollte sich das Buch „Kabel & Co.“ kaufen, dort wird alles Schritt für Schritt verständlich erklärt. Ganz perfekt ist das Buch leider auch nicht: Bei der Bild 55 betreffenden Berechnung wurde nämlich versehentlich die Kabeldämpfung nicht berücksichtigt. Dies kann man aber selbst korrigieren – als Beweis für den eigenen Durchblick!
Allen Leseratten einen guten Rutsch!
Frank, DL7VFS