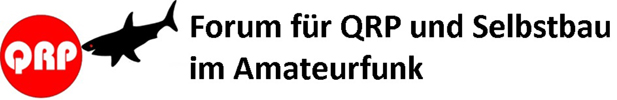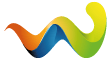Hallo Dirk
Ja, dank Heribert und Ralph, DL1HR konnte ich inzwischen das Kapitel 1 und die Originalbeschreibung der Schaltung selber nachlesen. Bezüglich einer Schaltungsbeschreibung gibt die aber auch nicht sehr viel her.
Unabhängig der im von dir verlinkten Video hervorragend veranschaulichten "grundsätzlichen Funktionsweise eines Direktmischers" finde ich vor allem die konkrete Umsetzung in der gegebenen Schaltung interessant. Selbstverständlich ist ein Nachbau möglich ohne konkretes Verständnis der gebauten Schaltung. In der QRP AG habe ich unseren Anspruch bisher aber doch anders verstanden.
Inzwischen habe ich die Schaltung soweit durchdrungen und nachgerechnet, dass ich sie z.B. wohl problemlos auf ein anderes Band umrechnen könnte....von daher könnte ich auch die jeweilige Funktion der einzelnen Bauteile erklären. Eine Funktionsbeschreibung wie in den Baumappen von QRP Project will ich aber niemanden aufdrängen. Sollte jemand aber Interesse oder konkrete Fragen haben kann er sich gerne an mich wenden.....