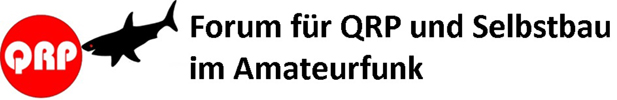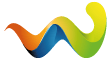Mehrfach kam der Hinweis auf SimNEC.
Ich selbst habe es nicht installiert, scheint eine eierlegende Wollmilchsau für Amateurfunk zu sein.
Die Beschreibung las ich durch, offensichtlich gut für Antennensimulation und deren Anpassungen.
Was ich nicht sehe, ist die Eignung für HF-Verstärker, Koppler, etc.
Dann solltest du ruhig mal einen Blick draufwerfen, es schadet nicht. SimNEC ist die Kombination der schon länger vorhandene Software SimSmith mit NEC (numerical electrical code) zur numerischen Simulation des Abstrahl und Impedanzverhaltens von Drahtantennen. Es kann also Beides, Antennen, Lumped-Elements wie Spulen, Kondensatoren, Trafos etc. und auch S-Parameter Importe verarbeiten. Und es hat den großen Vorteil einer intuitiv zu bedienenden grafischen Benutzeroberfläche.
Es ist allerdings nicht wie PUFF ein Mikrowellen CAD und ist nicht dazu gedacht, Filter, Striplines, Koppler oder Verstärkerschaltungen auf Leiterplatten zu designen und zu analysieren, was PUFF kann. Dafür gibt es allerdings mittlerweile auch grafisch bedienbare Programme, wie z. B. der Ansoft Designer, der in der Student Version als Freeware Version auf der Seite von Gunthard Kraus (sk) zum Download bereitsteht. Gunthard hat dazu, wie auch zu PUFF, ein hervorragendes Tutorial geschrieben.
Nach der unweigerlichen Frage, welches Programm für eines bestimmte Aufgabe das beste ist, meine ich: dasjenige, mit dem man vertraut ist und das man bedienen kann. Wer mit PUFF umgehen kann, hat damit ein sehr gutes Werkzeug an der Hand.
73, de
Günter