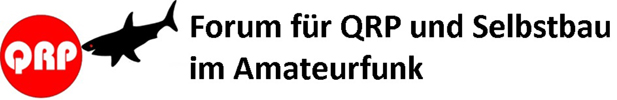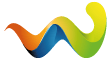Hallo Heiner,
die folgenden Empfänger sind in dem Stapel QRP-Reporte, der DERZEIT nachträglich versandt wird:
ALLE Empfänger mit einer Adresse außerhalb DL sowie DB3TK, DB4BJ, DB5WO, DC0SW, DC4CX, DD2QC, DD7GK, DF1UX, DF2MR, DF3GU, DF3JG, DF3KR, DF3ZF, DF4MS, DF4ZN, DF5TC, DF6OM, DF9GW, DF9IV, DG1LJP, DG1MEY, DG1NAH, DG1VJ, DG3FBP, DG3KCL, DG4ACF, DG4NCO, DG4SFS, DG5LR, DG6RCH, DG6SW, DG7SJK, DG8RCN, DH2MD, DH3BAJ, DH4FAI, DH4YM, DH8KAQ, DH8LAA, DH9SB, DJ1CT, DJ1KAIDJ2PS, DJ2UM, DJ2WL, DJ3EI, DJ3FR, DJ3KU, DJ3MQ, DJ4PZ, DJ4TT, DJ5AM, DJ5EF, DJ6KS, DJ7PU, DJ9EU, DJ9UA, DK1SAG, DK1UL, DK1VD, DK1ZQ, DK2FD, DK2IK, DK2MT, DK2TA, DK2WM, DK3IC, DK4AA, DK5ZC, DK6TM, DK6ZD, DK8TE, DK9HE, DK9NCX, DL1AL, DL1BFZ, DL1EGR, DL1GBY, DL1MFK, DL1TD, DL1TU, DL1VHS, DL1WE, DL1YAR, DL1ZU, DL2AWB, DL2NFC, DL2TB, DL3BC, DL3YV, DL4ABE, DL4FAB, DL4MFL, DL4MHY, DL5GBP, DL5HCM, DL6MMM, DL6NWA, DL6UBM, DL6UM, DL7AOJ, DL7BJ, DL7CHF, DL7FG, DL7MPA, DL7NIK, DL7UN, DL8AAX, DL8CS, DL8FV, DL8OBD, DL8UT, DL8UZ, DL9JFT, DL9MFN, DL9TX, DL9UT, DM1JH, DM1RE, DM1YP, DM2CMB, DM2CQL, DM5AS, DM5LM, DM6RAF, DO1AWO, DO1IJB, DO1LKG, DO2GHA, DO2JHE, DO2NMS, DO5GK, DO6DA, DO6DOC, DO9JW, DO9OM, QRP-02773, QRP-02966, QRP-02967, QRP-02987, QRP-02988, QRP-03030, QRP-03040, QRP-03047, QRP-03050, W8VKO.
73/72 de Ingo, DK3RED