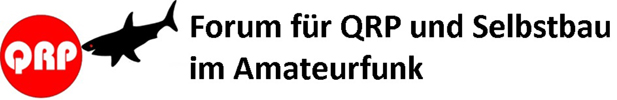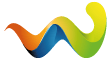Hallo Uwe, hallo Tom,
vor ein paar Wochen ist ein Evaluation Kit für den Si504 bei mir eingetroffen und die Software von SiLabs läuft inzwischen auch (es gab nen Bug mit nicht-US-Versionen von Windoof...).
Die Abweichung von der Nennfrequenz ist minimal, mein Exemplar liegt knapp 1,2 ppm drüber. Gemessen mit einem Racal-Dana 1999 mit Quarzofen nach genügend langer Aufwärmzeit (mehrere Stunden).
Folgende Stromaufnahme habe ich gemessen:
100MHZ, 3,3V, 8ns Anstiegszeit, low jitter, 50 Ohm Last: 7,7mA
dito, 0,7ns Anstiegszeit: 25mA (!)
Bei 1MHz und abgeklemmtem Koaxkabel zum Zähler fließen dann nur noch 4mA.
Leider habe ich derzeit keine genaue Möglichkeit, das Seitenbandrauschen zu messen, das Teil dürfte aber nicht ganz so gut sein wie der Si570 und Verwandte. Wenn ich wieder im QRL bin, werde ich mal den Tektronix RSA3308 im Labor bemühen, der hat eine Wasserfalldarstellung und einen recht rauscharmen Mutteroszillator.
Für einfache QRP-Transceiver dürfte er aber einen interessanten Mutteroszillator abgeben, wenn man den Aufwand eines "Coprozessors" zur Frequenzeinstellung und -anzeige nicht scheut. Denkbar wäre auch, über einen PIC und einen Wahlschalter die diversen "QRP-Hotspots" auswählbar zu machen, die dürfen dann gern auf verschiedenen Bändern liegen. Damit dürfte dann die Stromaufnahme immer noch unter 10mA liegen. Die Ablage für den CW-Betrieb wäre dann auch einfach machbar, es gibt einen Befehl für einen Offset im Kommunikationsprotokoll des Si504.
Da der Oszillator eine interne Spannungsstabilisierung hat, wäre auch ein Betrieb mit 2 Alkali-oder NiMH-Zellen möglich (1,7-3,6V). Prozessoren, die damit leben können, gibt es ebenfalls bei SiLabs (8051-Derivate).
Alles in allem, ein interessanter Baustein!
Gruß,
Rainer, DG1SMD