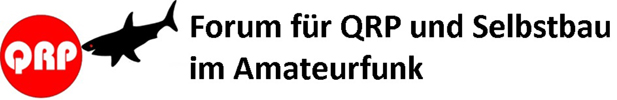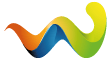Das ist eine allgemein gehaltene Prosa-Beschreibung, keine Spezifikation. Die wären in der Tabelle "electrical characteristics" als Leistungswert oder als Kurve angegeben. Dort findet man z. B. eine Angabe über den Kurzschlussstrom, aber nichts über die thermal Overload Protection.
Die Erörterung dieses einen Punktes ist auch nicht maßgeblich für die Nützlichkeit des vorgestellten Gerätes. Sie erwuchs ganz allgemein aus der Fragestellung nach der Zuverlässigkeit und der Reproduzierbarkeit der Übertemperatur Abschaltung des IC als Schutzmechanismus für ein Netzteil. Im Datenblatt des 78Lxx von Texas Instruments findet man zumindest eine Kurve der Verlustleistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur. Aber keine näheren Wert-Angaben unter welchen Umständen die Übertemperatursicherung anspricht und unter welchen Umständen der Schutz zurückgestellt wird.
73, de Günter
P.S. mittlerweile wurde der Datenblattauszug von DM5MK leider gelöscht, so dass der ursprüngliche Bezug dieses Post abhanden gekommen ist.