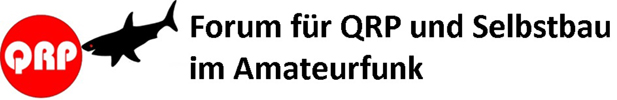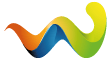Hallo Funkfreunde,
früher war alles besser! 
Früher lag jedem Röhrenradio noch ein Stromlaufplan bei. Wenn mal was war, konnte der Amateur Hand anlegen.
Mein Ziel ist es, herauszufinden, wie der Generator und dessen Regler funktioniert, wie stabil die Ausgangsspannung und Frequenz sind und wie rein der Sinus ist.
Der Hersteller meines Aggregates beantwortet Anfragen nicht. Ein Stromlaufplan fehlt.
Die Bedienanleitung verweist bei bestimmten Problemen auf den lokalen Händler…
Selbstreparatur ist nicht vorgesehen (230V). Den Austausch von defekten Komponenten erledigen autorisierte Servicetechniker.
Der Regler befindet sich unter einer schwarzen Vergussmasse (Vibrationen, Wärmeableitung, Nachbauschutz).
Heute ist alles besser! 
Wenn der Hersteller Anfragen nicht beantwortet, hilft eine Internetrecherche und ggf. eine Anfrage in einem Forum mit elektrotechnischem Hintergrund.
Ich habe Bedienanleitungen und Stromlaufpläne ähnlicher Aggregate und das Patent US6,522,106 (Honda) durchgesehen.
Das Ergebnis meines „Reverse Engineering“ findet ihr zusammengefasst in angehängter Skizze.
Mein Aggregat enthält einen zweipoligen Einphasenwechselstromgenerator- kein Inverter. Es handelt sich um eine Innenpolmaschine. Spannungsschwankungen durch Lastschwankungen werden durch Ändern des Stromes in der Erregerwicklung L3 ausgeglichen. Die Istspannung wird von Anzapfungen der Statorwicklung L1 abgegriffen. Eine zusätzliche Wicklung L2 im Stator erzeugt die Betriebsspannung für den Regler AVR.
Noch offene Fragen:
F1: Wozu braucht es die zusätzliche Statorwicklung L2? Die Betriebsspannung für den AVR könnte doch auch aus Anzapfungen der Ausgangswicklung L1 entnommen werden?
F2: Wie wird bei einem solchen Aggregat die Frequenz 50Hz eingehalten? Der Benziner sollte konstant mit 3000U/min laufen. Ich finde kein Stellglied in der Benzin- und/oder Verbrennungsluftzufuhr.
F3: Werden heute im AVR analoge oder gepulste Regler eingesetzt? Ich werde mal meinen Oszi dran hängen, ob Spitzen auf dem Sinus sind…
73, Roland, DF8IW
![]()