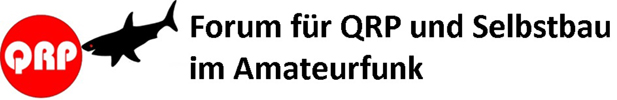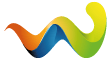Also der Fragesteller verlangt aus seiner Schaltung recht viel herauszulesen! Woher soll ich wissen, welche Induktivität eine Spule mit 7 Windungen hat? Nur die Parallelkapazität zur Spule ist eindeutig. Was die 45 MHz bedeuten sollen, habe ich bei der recht klein gehaltenen Schaltung zunächst nicht verstanden, sri.
Zum anderen habe ich noch nie erlebt, daß ein Oszillator schwingt, wenn zwischen Basis und Kollektor ein niederohmiges Schaltelement in Serienschaltung liegt! Auch die grundlegende Oszillatorschaltung mit einem Schwingkreis zwischen Gitter und Anode einer Röhre, der Hartley-Oszillator, ist ein Parallelresonanzelement! Darum bin ich nach wie vor der Meinung, daß der Quarz in dieser Schaltung auf seiner Parallelresonanz schwingt.
Im Grunde ist es bei dieser Oszillatorschaltung doch so, daß die Resonanz des Kollektorkreises die Größenordnung der erzeugten Oszillatorfrequenz bestimmt, also ob vom Quarz der Grundton oder ein Oberton genutzt werden soll. Denn der Kollektorkreis braucht in dieser Schaltung einen hochohmigen Arbeitswiderstand und hat ihn auch. Die genaue Frequenzlage bestimmt dann der Quarz. Ein Quarz kann also in dieser Schaltung sowohl auf seiner Grundfrequenz als auch auf einem Oberton erregt werden. Und selbst wenn der Quarz als Obertonquarz in Serienresonanz spezifiziert sein sollte, so wird er in dieser Schaltung in Parallelresonanz schwingen und daher eine etwas andere als die spezifizierte Frequenz erzeugen, einfach weil die Strecke zwischen Basis und Kollektor hier ebenfalls hochohmig sein muß, und das kann der Quarz nur in Parallelresonanz. Soll der Quarz in Serienresonanz arbeiten, muß er zwischen einer niederohmigen Quelle und einem niederohmigen Verstärkereingang geschaltet sein, also wie schon von OE1DEA beschrieben z. B. zwischen den Emittern zweier Transistoren.
Demnach müßte man also genau genommen einen Obertonquarz für eine ganz bestimmte Oszillatorschaltung spezifizieren, damit das Problem mit der genau spezifizierten Frequenz, das ich hier angeschnitten habe, nicht auftreten kann.
Oder?
Was die Verdopplerstufe betrifft, so würde ich dessen Kollektorkreis gleich mit einem Parallelkreis auf die verdreifachte Frequenz abstimmen (sollte die Stufe dann schwingen, wären kleine Widerstande in Reihe zu Basis und/oder Kollektor eine Abhilfe). Denn beim Verdreifachen entstehen ja auch durch das Verzerren des Kollektorstromes ein tieferer und weitere höherfrequente Frequenzanteile, und die sollte man gleich am Ausgang des Transistors so klein wie möglich halten. Für die Arbeitspunkteinstellung des Verdopplers würde ich einen einfachen Widerstand verwenden und seinen Wert auf maximale Ausgangsspannung optimieren, da er vom Maß der Ansteuerung abhängt.