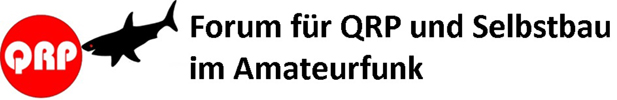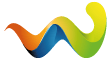Hallo allen Funkfreunden und Selbstbauern,
wie es vielleicht bei einigen auch vorkommt, so ist mir ein Aufbau bei Aufräumarbeiten wieder i n die Finger gekommen. Will ich da nun endlich ausprobieren, was ich mir zwischendurch überlegt habe oder entsorge ich?
Ich habe mich für das Probieren entschieden.
Mein oller 20m Rx wurde noch mal messtechnisch in Augenschein genommen. Damals hatte ich nicht die Messgeräte wie heute und so machte ich mich über die arg mitgenommene Leiterplatte her. Es stellten sich folgende Dinge heraus:
- Anders als im damals veröffentlichten Beitrag hatte ich im Zf-Verstärker irgendwann BF199 verbaut. Nun stellte sich heraus, dass Erregung im Bereich der Transitfrequenz rund um 500MHz messbar ist. Also ersetzte ich die Transistoren wie im damaligen Schaltbild ausgegeben und die Störung war weg.
- Meine "Temperaturkompensation" des VFO war auch Quark und ich ging gezielt mit passenden Kondensatoren neu ans Werk. Die Folge war ein passables Driften, das während eines Hördurchgangs über eine halbe Stunde nicht weiter stört. An dieser Stelle will ich noch mal ne Huff-Puff Stabilisierung testen.
- Mein Quarzfilter habe ich vom variablen Betrieb wieder auf Festwert von ca. 2,2 Khz umgebaut und von 4 auf 8 Quarze umgebaut.
- Zur Verringerung des Breitbandrauschens "bastelte" ich noch einen Bandpass mit 2 Quarzen und rund 3KHz Bandbreite vor den BFO.
- Was ich immer testen wollte, wie sich eine AGC auswirkt, die sich nicht (wie ich es damals machte) aus der Nf generiert wird. Pate war dabei die Schaltung, die ich im K2 "klaute". Dabei wird mittels Mischung mit einem Oszillatorsignal ein paar 100kHz in der Nähe der Zf eine neue Frequenz erzeugt, die dann nach Verstärkung und Gleichrichtung zur AGC herangezogen wird. Kein Ploppen und keine wahrnehmbare Verzögerung. Wow... so hört sich das doch gleich schön an!
Wenn ich schon beim "aufmotzen" bin, so schadet es auch nicht, wenn ich den Drahtverhau ein wenig bändige und die Leitungswege ordne. Gesagt, getan und mittels einiger Steckverbindungen für zukünftige versuche ist es nun weniger Lötarbeit, wenn ich was an der Leiterplatte ändern möchte.
Wäre es nicht interessant, wenn ich mit dem 20m RX (BFO fest für USB) auch 80 und 40 empfangen könnte? Klar! So nahm ich gleich die nächste "Langzeitbaustelle" mit dazu....der rudimentäre RX
Mein erweiteter RX Aufbau, bei dem ich hier an anderer Stelle meine Messergebnisse zu der Bandfilterbaugruppe eingestellt habe. Eigentlich sind schon alle Baugruppen für den RX einzeln getestet aber noch nicht verdrahtet- nur das braucht eben Zeit.....
Im Aufbau des RX ist erst einmal ein Oszillator mit dem Si570 vorgesehen und im Mischer werkelt ein Tuf Ringmischer mit Anpassverstärker für den VFO und Diplexer am Zf Port.
So aus Lust und Laune- und weil alles so luftig frei verdrahtet ist, kann man ja mal "spielen". Also kurz überlegt und den Zf Port des Neubau RX an den 20m RX. Den Oszillatorbaustein (NeuRX) mit einer festen Offsetfrequenz -hier 14,2MHz- versehen. Der Offset wird zur Anzeige addiert, damit man für 80 und 40m seitenbandrichtig auch SSB empfangen kann.
HEUREKA- es klappt. Es klappt so erstaunlich gut, dass ich mich wundere, wenn ich in QSO Anderer alle hören kann und die anderen OM mitunter sich nicht hören können. Dabei haben die meisten dieser OM Geräte, die reichlich kosten... Meine Antenne und mein QTH sind in meinen Augen nicht besonders hftechnisch gut. Was mich umso mehr freut, wenn mein "Murks" denn dann doch funktioniert...
Vielleicht wird der Neu RX ja nun endlich fertig...
Selbstbau bringt eben immer mehr Spass, als das Fertiggerät vom Händler...
vy 73
Andy
DK3JI